Vergaser und Einspritzanlagen
Historische Gemischbildung
28. April 2025 agvs-upsa.ch – Bei Oldtimern sucht der Werkstattprofi eine OBD-Schnittstelle zum Anschliessen eines Diagnosegerätes vergebens. Modernste Prüftechnik kann aber zielführend eingesetzt werden, um die Gemischbildungssysteme vergangener Tage auch heute zu prüfen, Diagnosen zu erstellen und Einstellungen vorzunehmen. Andreas Senger

Mit modernsten Diagnosetestern können zwar keine OBD-Schnittstellen eines historischen Fahrzeuges verbunden, aber die Messtechnik eingesetzt werden. Foto: Bosch
Moderne Diagnoseabläufe starten mit einer Routine: Tester an der OBD-Schnittstelle anschliessen und alle Steuergeräte und deren Fehlerspeicher abfragen, um die Kundenbeanstandung und damit eine Fehlfunktion allenfalls durch vollautomatisiertes Auffinden beheben zu können. Ein Softwareupdate, einen defekten Sensor wechseln oder ein Problem eines Bussystems punkto Kommunikation lösen und das Fahrzeug ist repariert. Die Diagnosepfade moderner Fahrzeugsysteme sind zwar weit verzweigt und decken eine Vielzahl von Fällen ab, aber nie 100 Prozent. Diagnoseprofis wissen es: Das Auffinden von Defekten benötigt ein vertieftes und vernetztes Fachwissen der Fahrzeugsysteme. Das Ausschliessen und Eingrenzen ist mitunter Detektivarbeit, sorgt aber für Befriedigung bei der Arbeit, wenn nicht einfach mittels Diagnosetester der Fehler gefunden wird, sondern eine technische Weiterbildung als Automobildiagnostiker: in oder die Weiterbildung beim Automobilimporteur Früchte trägt.
Bei historischen Fahrzeugen gestaltet sich die Fehlersuche identisch, aber ohne Diagnosetester. Lässt sich ein Fahrzeug mit Vergasermotor nicht starten, gilt es die Starteranlage (Batterie Ladezustand, Anlasser Einrückvorgang), die Zündanlage und die Treibstoffversorgung zu kontrollieren, um den Verbrenner wieder starten zu können. Die Vorgehensweise bei der Diagnose von älteren Fahrzeugen unterscheidet sich nicht von heutigen. Schrittweises Vorgehen und mit dem Ausschlussverfahren arbeiten, führt zum Ziel. Und deshalb können auch heutige Werkstattprofis durch Einlesen in historische Fahrzeugtechnik den einen oder anderen Fehler finden (Markenclubs haben tolle Infotheken), in dem Sie ein logisches Diagnosevorgehen mit dem Know-how in der modernen Messtechnik verknüpfen und umsetzen.

Bevor der Leerlauf oder das Gemisch kontrolliert oder eingestellt wird, muss immer zuerst die Zündanlage geprüft werden. Ein CO-Messgerät (auf Wagen unten) misst den Kohlenmonoxidgehalt. Foto: Robert Bosch GmbH, Archiv
Schrittweises Vorgehen
Bei Vergaserfahrzeugen sind elektrische Defekte rar. Nur wenige Systeme wie Kaltstartanreicherung oder ein Abstellmagnetventil sind elektrisch angesteuert. Selbstverständlich gab es auch geregelte Vergaser, die den Betrieb eines Dreiwegekatalysators und damit die strengen CH-Vorschriften punkto Emissionen erfüllen konnten. Aber grundsätzlich sind Vergasermotoren eher bei mechanischen oder hydraulischen Problemen einer Panne ausgesetzt. Bevor die komplexen Wunderwerke der Mechanik auseinandergenommen werden, sollte zuerst immer geprüft werden, ob ein Zündfunke vorhanden ist. Eine Prüfkerze hilft, bei ausgezogenem Zündkerzenstecker durch Anlassen optisch zu erkennen, ob Funken entstehen.
Ist die Zündanlage funktionsfähig, liegt es entweder an der Treibstoffzufuhr oder tatsächlich dem Vergaser selbst. Meist sind eher Treibstoffpumpen, die mechanisch mittels Membrane Treibstoff fördern, verstopfte Treibstofffilter oder verrostete Treibstofftanks der Störfaktor. Durch die Korrosion verschliesst sich die Treibstoffleitung und das Benzin kann nicht bis zur Treibstoffpumpe fliessen. Oft sind sich die Fahrerinnen und Fahrer sich nicht bewusst, dass bei mechanischen Chokes dieser im Fahrzeuginnenraum beim Kaltstart betätigt und danach schrittweise zurückgestellt werden muss. Fährt eine Oldtimer-Besitzerin oder ein Oldtimer-Besitzer mit ständig gezogenem Choke, steigt der Benzinverbrauch ins Unermessliche und das Gemisch ist zu fett. Vergisst man die Chokeklappe zu betätigen, lässt sich ein Vergasermotor nur schwerlich starten, da die Anfettung des Gemisches durch den zusätzlichen Unterdruck fehlt. Eine Kontrolle der Betätigungseinrichtung sowie des Gaskabels gehören zur Sichtprüfung. Ist die Peripherie in Ordnung, kann eine Grundreinigung des Vergasers und Ersatz aller Dichtungen (Reparatursätze sind erhältlich) hilfreich sein.

Mehrvergaseranlagen müssen für einen optimalen Motorlauf zwingend synchronisiert werden. Foto: Porsche
Mechanische Einspritzanlagen
Verfügt das Fahrzeug über eine Einspritzanlage, kann das Prüfequipment moderner Werkstätten eher eingesetzt werden. Ausser bei einer K-Jetronic, die ebenfalls nur wenige elektrische Bauteile aufweist, ist der Einsatz der Messinfrastruktur gewinnbringend. Auf der Versorgungsseite arbeiten meist elektrisch angetriebene Treibstoffpumpen, die wiederum von einem Relais mit Strom versorgt werden. Wie bei modernen Fahrzeugen lohnt sich der Blick auf den Stromlaufplan des jeweiligen Modells, um alle potentiellen Störquellen zu definieren. Selbst bei einer kontinuierlich einspritzenden KE-Jetronic (Dreiwegekatalysatorbetrieb) wird der Umfang der Steuer- und Regeleinrichtungen grösser: Kaltstartventil inkl. Temperatursensor, Zusatzluftschieber für Leerlaufregelung und Systemdruckregler für den Lambdasondebetrieb für den Dreiwegekatalysator. Nebst der mechanischen Staubklappe, welche die Luftmenge erfasst und die Treibstoffmenge zumisst, sind also diverse Regelsysteme verbaut, die über die Jahre zu Problemen führen können.
Die Grundeinstellung ist aber wie bei Vergasern identisch. Mit dem Anstellwinkel der Drosselklappe wird beim Vergaser die Leerlaufdrehzahl justiert. Bei einer K- oder KE-Jetronic sowie späteren Einspritzsystemen wie die L-Jetronic wird eine Grundeinstellung über die Leerlaufeinstellschraube vorgenommen (Bypass zur Drosselklappe, Leerlaufregelung in diesem Moment ausschalten). Ist der Leerlauf frisch eingestellt, wird mittels Abgastestgerät das Kohlenmonoxid erfasst, welches als Grundgrösse für die Gemischzusammensetzung bildet. Bei Vergasermotoren wird das Gemisch mittels Gemischschraube so eingestellt, dass ein leicht fetter Betrieb realisiert wird. Durch den Überschuss an Benzin im Vergleich zur Luft ist ein sauberes Ansprechen beim Beschleunigen realisierbar. Allerdings spürt der Werkstattprofi rasch, wenn es zu viel wird. Je höher der Kohlenmonoxidgehalt CO im Abgas, desto fetter ist das Gemisch, also das Lambdaverhältnis kleiner als 1. Die Erfahrungswerte für eine optimale Vergasereinstellung ist ebenfalls bei Markenclubs abrufbar oder Reparaturanleitungen zu entnehmen.
Bei der rechts unten abgebildeten KE-Jetronic erfolgt die Grundeinstellung des Gemisches durch Ausserbetriebsetzung der Lambdaregelung (Abstecken der Kabel am Treibstoffmengenteiler). Mittels langem Imbusschlüssel kann beim Mengenteiler nach Entfernen der Abdeckung die Grundstellung bei laufendem Motor vorgenommen werden (nie bei eingestecktem Imbusschlüssel Gas geben, verbiegen der Stauscheibengestänge). Auch hier gibt es Vorgaben über den CO-Gehalt und die Messstelle für den Abgastester ist konsequenterweise als separates Entnahmerohr vor dem Dreiwegekatalysator.

Eine Reiheneinspritzpumpe eines Dieselmotors können heute nur noch wenige Fachspezialistinnen und Fachspezialisten professionell prüfen, den Förderbeginn einstellen und die Einspritzmenge pro Pumpeneinheit kalibrieren. Foto: Robert Bosch Gmbh, Archiv
Vor-/Wirbelkammer-Selbstzünder
Bei Oldtimer-Dieselfahrzeugen fällt zwar die Zündung weg, dafür ist die Kontrolle, ob bis zum Einspritzsystem Treibstoff vorhanden ist und ob der Vordruck stimmt, identisch. Zudem ist es ratsam, die Vorglühanlage zu prüfen, um die Vorkonditionierung der Vorkammer oder Wirbelkammer temperaturmässig sicherzustellen. Mittels Strommesszange moderner Diagnoseterminals lässt sich dies einfach überprüfen. Ältere Reihen- und Verteilereinspritzpumpen arbeiten rein mechanisch. Hier lässt sich einzig der Förderbeginn überprüfen (analog dem Zündzeitpunkt bei Ottomotoren).
Handelt es sich um eine modernere Einspritzanlage, sind sowohl bei Reihen- wie Verteilereinspritzpumpen elektronische Zusatzsysteme wie die elektronische Dieseleinspritzkontrollen (Steuergeräte) verbaut. Hier wird der Förderbeginn des ersten Zylinders mittels Düsennadelhuberkennung umgesetzt, um eine Feinjustage im Betrieb zu realisieren. Auch können Last und Drehzahl besser adaptiert werden. Um mechanische Dieselpumpen zu prüfen, reparieren und erneut zu prüfen, ist ein Prüfstand notwendig. Darüber verfügen nur noch wenige, spezialisierte Firmen in der Schweiz.
Vor historischer Fahrzeugtechnik brauchen sich Werkstattprofis also nicht zu verstecken. Wer die aktuelle Messtechnik im Griff hat, kann diese auch bei älteren Fahrzeugen gewinnbringend einsetzen und Diagnosen mit modernstem Equipment durchführen.

Gewusst wie: Leerlaufdrehzahl (rot) und Gemisch (gelb) lassen sich bei einer K-Jetronic einstellen. Ein Abgastester mit Drehzahlmesser genügt, um die Einstellung vorzunehmen. Foto: Bosch Schulungsunterlagen, Archiv

Mit modernsten Diagnosetestern können zwar keine OBD-Schnittstellen eines historischen Fahrzeuges verbunden, aber die Messtechnik eingesetzt werden. Foto: Bosch
Moderne Diagnoseabläufe starten mit einer Routine: Tester an der OBD-Schnittstelle anschliessen und alle Steuergeräte und deren Fehlerspeicher abfragen, um die Kundenbeanstandung und damit eine Fehlfunktion allenfalls durch vollautomatisiertes Auffinden beheben zu können. Ein Softwareupdate, einen defekten Sensor wechseln oder ein Problem eines Bussystems punkto Kommunikation lösen und das Fahrzeug ist repariert. Die Diagnosepfade moderner Fahrzeugsysteme sind zwar weit verzweigt und decken eine Vielzahl von Fällen ab, aber nie 100 Prozent. Diagnoseprofis wissen es: Das Auffinden von Defekten benötigt ein vertieftes und vernetztes Fachwissen der Fahrzeugsysteme. Das Ausschliessen und Eingrenzen ist mitunter Detektivarbeit, sorgt aber für Befriedigung bei der Arbeit, wenn nicht einfach mittels Diagnosetester der Fehler gefunden wird, sondern eine technische Weiterbildung als Automobildiagnostiker: in oder die Weiterbildung beim Automobilimporteur Früchte trägt.
Bei historischen Fahrzeugen gestaltet sich die Fehlersuche identisch, aber ohne Diagnosetester. Lässt sich ein Fahrzeug mit Vergasermotor nicht starten, gilt es die Starteranlage (Batterie Ladezustand, Anlasser Einrückvorgang), die Zündanlage und die Treibstoffversorgung zu kontrollieren, um den Verbrenner wieder starten zu können. Die Vorgehensweise bei der Diagnose von älteren Fahrzeugen unterscheidet sich nicht von heutigen. Schrittweises Vorgehen und mit dem Ausschlussverfahren arbeiten, führt zum Ziel. Und deshalb können auch heutige Werkstattprofis durch Einlesen in historische Fahrzeugtechnik den einen oder anderen Fehler finden (Markenclubs haben tolle Infotheken), in dem Sie ein logisches Diagnosevorgehen mit dem Know-how in der modernen Messtechnik verknüpfen und umsetzen.

Bevor der Leerlauf oder das Gemisch kontrolliert oder eingestellt wird, muss immer zuerst die Zündanlage geprüft werden. Ein CO-Messgerät (auf Wagen unten) misst den Kohlenmonoxidgehalt. Foto: Robert Bosch GmbH, Archiv
Schrittweises Vorgehen
Bei Vergaserfahrzeugen sind elektrische Defekte rar. Nur wenige Systeme wie Kaltstartanreicherung oder ein Abstellmagnetventil sind elektrisch angesteuert. Selbstverständlich gab es auch geregelte Vergaser, die den Betrieb eines Dreiwegekatalysators und damit die strengen CH-Vorschriften punkto Emissionen erfüllen konnten. Aber grundsätzlich sind Vergasermotoren eher bei mechanischen oder hydraulischen Problemen einer Panne ausgesetzt. Bevor die komplexen Wunderwerke der Mechanik auseinandergenommen werden, sollte zuerst immer geprüft werden, ob ein Zündfunke vorhanden ist. Eine Prüfkerze hilft, bei ausgezogenem Zündkerzenstecker durch Anlassen optisch zu erkennen, ob Funken entstehen.
Ist die Zündanlage funktionsfähig, liegt es entweder an der Treibstoffzufuhr oder tatsächlich dem Vergaser selbst. Meist sind eher Treibstoffpumpen, die mechanisch mittels Membrane Treibstoff fördern, verstopfte Treibstofffilter oder verrostete Treibstofftanks der Störfaktor. Durch die Korrosion verschliesst sich die Treibstoffleitung und das Benzin kann nicht bis zur Treibstoffpumpe fliessen. Oft sind sich die Fahrerinnen und Fahrer sich nicht bewusst, dass bei mechanischen Chokes dieser im Fahrzeuginnenraum beim Kaltstart betätigt und danach schrittweise zurückgestellt werden muss. Fährt eine Oldtimer-Besitzerin oder ein Oldtimer-Besitzer mit ständig gezogenem Choke, steigt der Benzinverbrauch ins Unermessliche und das Gemisch ist zu fett. Vergisst man die Chokeklappe zu betätigen, lässt sich ein Vergasermotor nur schwerlich starten, da die Anfettung des Gemisches durch den zusätzlichen Unterdruck fehlt. Eine Kontrolle der Betätigungseinrichtung sowie des Gaskabels gehören zur Sichtprüfung. Ist die Peripherie in Ordnung, kann eine Grundreinigung des Vergasers und Ersatz aller Dichtungen (Reparatursätze sind erhältlich) hilfreich sein.

Mehrvergaseranlagen müssen für einen optimalen Motorlauf zwingend synchronisiert werden. Foto: Porsche
Mechanische Einspritzanlagen
Verfügt das Fahrzeug über eine Einspritzanlage, kann das Prüfequipment moderner Werkstätten eher eingesetzt werden. Ausser bei einer K-Jetronic, die ebenfalls nur wenige elektrische Bauteile aufweist, ist der Einsatz der Messinfrastruktur gewinnbringend. Auf der Versorgungsseite arbeiten meist elektrisch angetriebene Treibstoffpumpen, die wiederum von einem Relais mit Strom versorgt werden. Wie bei modernen Fahrzeugen lohnt sich der Blick auf den Stromlaufplan des jeweiligen Modells, um alle potentiellen Störquellen zu definieren. Selbst bei einer kontinuierlich einspritzenden KE-Jetronic (Dreiwegekatalysatorbetrieb) wird der Umfang der Steuer- und Regeleinrichtungen grösser: Kaltstartventil inkl. Temperatursensor, Zusatzluftschieber für Leerlaufregelung und Systemdruckregler für den Lambdasondebetrieb für den Dreiwegekatalysator. Nebst der mechanischen Staubklappe, welche die Luftmenge erfasst und die Treibstoffmenge zumisst, sind also diverse Regelsysteme verbaut, die über die Jahre zu Problemen führen können.
Die Grundeinstellung ist aber wie bei Vergasern identisch. Mit dem Anstellwinkel der Drosselklappe wird beim Vergaser die Leerlaufdrehzahl justiert. Bei einer K- oder KE-Jetronic sowie späteren Einspritzsystemen wie die L-Jetronic wird eine Grundeinstellung über die Leerlaufeinstellschraube vorgenommen (Bypass zur Drosselklappe, Leerlaufregelung in diesem Moment ausschalten). Ist der Leerlauf frisch eingestellt, wird mittels Abgastestgerät das Kohlenmonoxid erfasst, welches als Grundgrösse für die Gemischzusammensetzung bildet. Bei Vergasermotoren wird das Gemisch mittels Gemischschraube so eingestellt, dass ein leicht fetter Betrieb realisiert wird. Durch den Überschuss an Benzin im Vergleich zur Luft ist ein sauberes Ansprechen beim Beschleunigen realisierbar. Allerdings spürt der Werkstattprofi rasch, wenn es zu viel wird. Je höher der Kohlenmonoxidgehalt CO im Abgas, desto fetter ist das Gemisch, also das Lambdaverhältnis kleiner als 1. Die Erfahrungswerte für eine optimale Vergasereinstellung ist ebenfalls bei Markenclubs abrufbar oder Reparaturanleitungen zu entnehmen.
Bei der rechts unten abgebildeten KE-Jetronic erfolgt die Grundeinstellung des Gemisches durch Ausserbetriebsetzung der Lambdaregelung (Abstecken der Kabel am Treibstoffmengenteiler). Mittels langem Imbusschlüssel kann beim Mengenteiler nach Entfernen der Abdeckung die Grundstellung bei laufendem Motor vorgenommen werden (nie bei eingestecktem Imbusschlüssel Gas geben, verbiegen der Stauscheibengestänge). Auch hier gibt es Vorgaben über den CO-Gehalt und die Messstelle für den Abgastester ist konsequenterweise als separates Entnahmerohr vor dem Dreiwegekatalysator.

Eine Reiheneinspritzpumpe eines Dieselmotors können heute nur noch wenige Fachspezialistinnen und Fachspezialisten professionell prüfen, den Förderbeginn einstellen und die Einspritzmenge pro Pumpeneinheit kalibrieren. Foto: Robert Bosch Gmbh, Archiv
Vor-/Wirbelkammer-Selbstzünder
Bei Oldtimer-Dieselfahrzeugen fällt zwar die Zündung weg, dafür ist die Kontrolle, ob bis zum Einspritzsystem Treibstoff vorhanden ist und ob der Vordruck stimmt, identisch. Zudem ist es ratsam, die Vorglühanlage zu prüfen, um die Vorkonditionierung der Vorkammer oder Wirbelkammer temperaturmässig sicherzustellen. Mittels Strommesszange moderner Diagnoseterminals lässt sich dies einfach überprüfen. Ältere Reihen- und Verteilereinspritzpumpen arbeiten rein mechanisch. Hier lässt sich einzig der Förderbeginn überprüfen (analog dem Zündzeitpunkt bei Ottomotoren).
Handelt es sich um eine modernere Einspritzanlage, sind sowohl bei Reihen- wie Verteilereinspritzpumpen elektronische Zusatzsysteme wie die elektronische Dieseleinspritzkontrollen (Steuergeräte) verbaut. Hier wird der Förderbeginn des ersten Zylinders mittels Düsennadelhuberkennung umgesetzt, um eine Feinjustage im Betrieb zu realisieren. Auch können Last und Drehzahl besser adaptiert werden. Um mechanische Dieselpumpen zu prüfen, reparieren und erneut zu prüfen, ist ein Prüfstand notwendig. Darüber verfügen nur noch wenige, spezialisierte Firmen in der Schweiz.
Vor historischer Fahrzeugtechnik brauchen sich Werkstattprofis also nicht zu verstecken. Wer die aktuelle Messtechnik im Griff hat, kann diese auch bei älteren Fahrzeugen gewinnbringend einsetzen und Diagnosen mit modernstem Equipment durchführen.

Gewusst wie: Leerlaufdrehzahl (rot) und Gemisch (gelb) lassen sich bei einer K-Jetronic einstellen. Ein Abgastester mit Drehzahlmesser genügt, um die Einstellung vorzunehmen. Foto: Bosch Schulungsunterlagen, Archiv
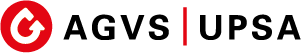

Kommentar hinzufügen
Kommentare